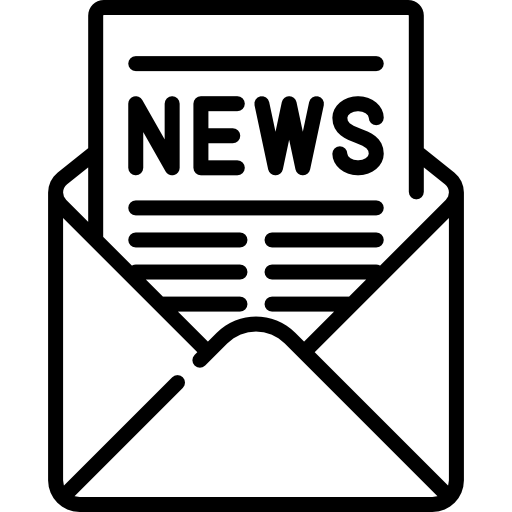UNTER WELCHEN UMSTÄNDEN DÜRFEN ANGEHÖRIGE ALS GESETZLICHE BETREUERIN ODER BETREUER ABGELEHNT WERDEN?
11.06.2025 – (Aktuelle Rechtsprechung)
Angehörige, die zur Übernahme der Betreuung bereit sind, dürfen grundsätzlich nur dann zugunsten einer Berufsbetreuerin oder eines Berufsbetreuers übergangen werden, wenn sie hierfür nicht geeignet sind. Nicht geeignet für eine konkrete Betreuung ist nach § 1816 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nur eine Person, die nicht willens oder in der Lage ist, in dem gerichtlich angeordneten Aufgabenkreis nach Maßgabe des § 1821 BGB die Wünsche und den mutmaßlichen Willen der zu betreuenden Person zu ermitteln und angemessen umzusetzen und in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlichen Kontakt mit der oder dem Betreuten zu halten.
Bundesgerichtshof (BGH), Beschluss vom 05.03.2025, Az. XII ZB 260/24
Das ist passiert
Die im Jahr 1934 geborene Frau leidet an einer Aphasie und schweren psychischen Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns nach Reanimation, Intubation und Beatmung. Ihre rechtlichen Angelegenheiten kann sie deshalb nicht mehr besorgen. Das Amtsgericht hat eine Betreuung mit einem umfassenden Aufgabenkreis eingerichtet und einen Berufsbetreuer und eine Verhinderungsbetreuerin bestellt. Den zuvor für einige Aufgabenbereiche zum vorläufigen Betreuer bestellten Sohn der Betroffenen hat das Amtsgericht als zur Führung der Betreuung nicht geeignet erachtet.
Die auf die Betreuerauswahl beschränkte Beschwerde des Sohnes der Betroffenen hat das Landgericht zurückgewiesen. Mit seiner Rechtsbeschwerde erstrebt er weiterhin seine Bestellung zum Betreuer.
Das Landgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, der Sohn der Betroffenen sei als Betreuer nicht geeignet. Diese Annahme gründet sich auf das in der Vergangenheit zutage getretene Verhalten des Sohnes, das dieser selbst als wenig vernünftig beschrieben habe. Zum einen habe er die Pflegeeinrichtung, in der sich seine Mutter aufhalte, zu unpassenden Zeiten – sogar in den Nachtstunden – aufgesucht und dort den geregelten Ablauf gestört. Zum anderen habe er im Beisein der Verfahrenspflegerin wiederholt die Bettdecke seiner Mutter hochgehoben und an ihrer Windel genestelt. Übergriffig wirke auch die Schilderung des Sohnes, er habe in der Vergangenheit mit seiner Mutter das Bett geteilt.
Nach Auffassung des Landgerichts ist eine andere Einschätzung auch nicht durch den Einwand des Sohnes gerechtfertigt, sein Verhalten habe sich nach der Verbesserung des Zustands seiner Mutter geändert und er wolle sich in künftigen Ausnahmesituationen vernünftiger verhalten. Denn dabei handele es sich nur um eine Absichtserklärung und es stehe nicht fest, dass sich der Sohn auch tatsächlich entsprechend umsichtig verhalten werde. Ein geeigneter ehrenamtlicher Betreuer stehe also nicht zur Verfügung. Die Entscheidung des Amtsgerichts, den Berufsbetreuer und die Verhinderungsbetreuerin einzusetzen, ist nicht zu beanstanden.
Der durch die Rechtsbeschwerde des Sohnes angerufene BGH hielt die zulässige Rechtsbeschwerde für begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Landgericht.
Darum geht es
Es geht darum, festzustellen, ob das Landgericht den Sohn zu Recht als Betreuer der Mutter abgelehnt hat.
Die Entscheidung
Der BGH ist der Auffassung, dass der Sohn zu Recht rügt, dass die Betreuerauswahl auf verfahrensfehlerhaften Feststellungen beruht.
Gemäß § 1816 Abs. 2 Satz 1 BGB ist dem Wunsch des Betroffenen, von einer bestimmten Person betreut zu werden, zu entsprechen. Es sei denn, diese Person ist zur Führung der Betreuung nicht geeignet. Hat der Betroffene niemanden als Betreuer vorgeschlagen, sind bei der Betreuerauswahl nach § 1816 Abs. 3 BGB die familiären Beziehungen des Betroffenen, insbesondere zum Ehegatten, zu Eltern und zu Kindern, seine persönlichen Bindungen sowie die Gefahr von Interessenkonflikten zu berücksichtigen. Durch diese Regelung wird dem Schutz der Familie auch bei der Betreuerbestellung Rechnung getragen. Erklärt sich ein Familienangehöriger bereit, die Betreuung zu übernehmen und steht dem kein (gemäß § 1816 Abs. 2 BGB vorrangiger) Wunsch des Betroffenen entgegen, muss die Bestellung eines familienfremden Betreuers ausführlich begründet werden.
Wie sich aus § 1816 Abs. 5 Satz 1 BGB ergibt, hat die ehrenamtliche Betreuung vor einer beruflich geführten Betreuung Vorrang. Ein Angehöriger, der zur Übernahme der Betreuung bereit ist, darf grundsätzlich nur dann zugunsten eines Berufsbetreuers übergangen werden, wenn er hierfür nicht geeignet ist.
Nicht geeignet für eine konkrete Betreuung ist nach § 1816 Abs. 1 BGB derjenige, der nicht willens oder in der Lage ist, in dem gerichtlich angeordneten Aufgabenkreis nach Maßgabe des § 1821 BGB die Wünsche und den mutmaßlichen Willen des Betreuten zu ermitteln und adäquat umzusetzen und in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten. Von einer fehlenden persönlichen Eignung ist danach auszugehen, wenn das Gericht anhand konkreter Tatsachen erhebliche Interessenkonflikte feststellt oder wenn ein Missbrauch eines zu der betroffenen Person bestehenden Vertrauensverhältnisses durch den potenziellen Betreuer zu befürchten ist.
Bei der Frage, ob eine Person als ungeeignet erscheint, darf das Gericht sich nicht auf eine Gewichtung einzelner Tatsachen oder Vorfälle beschränken. Er hat vielmehr eine Gesamtschau all derjenigen Umstände vorzunehmen, die für und gegen eine Eignung sprechen könnten, und eine Prognoseentscheidung dahin gehend zu treffen, ob die infrage stehende Person die aus der konkreten Betreuung erwachsenden Aufgaben (§ 1821 BGB) in Zukunft erfüllen kann.
Nach diesem Prüfungsmaßstab ist die getroffene Betreuerauswahl zu beanstanden. Zwar hat das Landgericht den zur Übernahme der Betreuung bereiten Sohn der Betroffenen zutreffend als bei der Auswahl vorrangig zu berücksichtigenden Angehörigen erachtet. Die Annahme der Ungeeignetheit des Sohnes beruht jedoch auf verfahrensfehlerhaften Feststellungen.
Das Landgericht hat maßgeblich auf das Verhalten des Sohnes in der Vergangenheit abgestellt, als er die Pflegeeinrichtung zur Unzeit aufgesucht und gegenüber seiner Mutter ein übergriffiges Verhalten gezeigt habe. Einer Absichtserklärung des Sohnes, sich in künftigen Ausnahmesituationen anders verhalten zu wollen, hat es keine Bedeutung beigemessen. Die Rechtsbeschwerde rügt zu Recht, dass das Landgericht in seine Prognoseentscheidung eine aktuelle Bescheinigung der Pflegeeinrichtung nicht einbezogen hat. Danach sei der Sohn zwar zu Beginn der Behandlung seiner Mutter emotional sehr betroffen und um ihre Gesundheit besorgt gewesen. Aufgrund der vorgefallenen Ereignisse und gesundheitlichen Rückschläge seiner Mutter im Krankenhaus habe er sich in einer emotionalen Notsituation befunden. Er habe sich aber schnell an die vorliegende Situation angepasst sowie Vertrauen in das Pflegeheim und das Betreuungspersonal gefasst, was zu einer wesentlichen Entspannung der Situation für ihn und seine Mutter geführt habe. Der Sohn sei gern in der Einrichtung gesehen, da er das Pflegepersonal wesentlich bei der schweren und belastenden Arbeit entlaste und sich fürsorglich und beispielhaft um seine Mutter kümmere.
Diese Ausführungen legen nahe, dass es – entgegen der Annahme des Landgerichts – tatsächlich bereits zu einer Verhaltensänderung gekommen ist, insoweit also gerade nicht lediglich eine bloße Absichtserklärung des Sohnes vorliegt. Das Landgericht hätte weiter ermitteln müssen, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob auch das aktuelle Verhalten des Sohnes noch Anhaltspunkte für die Annahme bietet, er werde die aus der konkreten Betreuung erwachsenden Aufgaben in Zukunft nicht erfüllen können.
Das bedeutet die Entscheidung für die Praxis
Erklären sich Angehörige zu dem schwierigen Ehrenamt bereit, eine gesetzliche Betreuung zu übernehmen, dann ist ihre Eignung vom Gericht umfassend zu prüfen. Keinesfalls darf das Gericht dabei nur auf vergangenes Verhalten der Angehörigen abstellen. Wichtig ist vor allem, ob die oder der Angehörige zurzeit und künftig als betreuende Person geeignet ist.
Quelle: Bundesgerichtshof (BGH), Beschluss vom 05.03.2025, Az. XII ZB 260/24